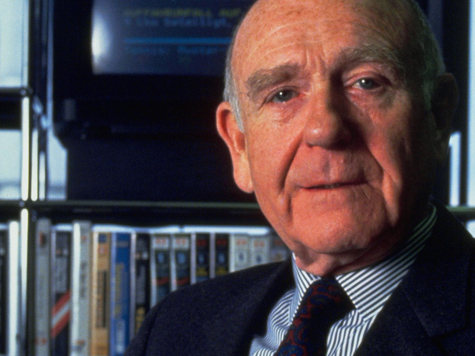Wer sich mit Volksgruppen, nationalen oder ethnischen Gemeinschaften, befasst, stößt alsbald auf eine „alte Frage im neuen Europa“, wie der Südtiroler Minderheiten-Experte Christoph Pan einmal treffsicher feststellte, nämlich auf die nach den autochthonen Minoritäten. „Alte Frage“, weil sie mit der Formung der „nationalen Idee“ sowie der Herausbildung der Nationalstaaten aufkommt und schließlich Resultat rigider Sieger-Grenzziehung ist: nach dem Ersten Weltkrieg, bei der weder auf Selbstbestimmung noch auf die 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Wilson Bedacht genommen wurde, sondern man die Grenzen willkürlich und nicht nach der Sprach- oder Volkszugehörigkeit zog. Ebenso wie nach dem Zweiten Weltkrieg, da man sie, soweit es Deutsche und Ungarn betraf, mittels „Bevölkerungstransfers“ – will sagen: Vertreibung – ein für alle Mal zu beantworten suchte.
Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, dessen Regime jede nationale Minderheit zugunsten der „Entwicklung eines neuen Menschentypus“ einzuschmelzen trachtete, zeigt(e) sich vielerorts, welche Explosivkräfte unter der Decke schlummer(te)n: Man denke beispielsweise an die seinerzeit nur durch NATO-Bombardement in Serbien gestoppte „ethnische Flurbereinigung“, welche Belgrad im Kosovo beabsichtigte. Oder eben an Konflikte, die wegen magyarischer Volksgruppen zwischen Ungarn und seinen Nachbarn stehen, besonders zwischen Budapest und Pozsony (Bratislava/Pressburg) sowie Bukarest.
Ungarn kritisieren slowakisches Sprachgesetz
So ist trotz der seit geraumer Zeit verbesserten Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei noch immer das umstrittene slowakische Sprachgesetz im Kern in Kraft, das von den hauptsächlich in der Südslowakei beheimateten ethnischen Ungarn und von Budapest zurecht kritisiert wird, wenngleich durch eine leichte Novellierung die Möglichkeiten der Verwendung der Minderheitensprachen im Verkehr mit Behörden erweitert worden sind. Die Novelle, die seinerzeit auf Initiative des von der slowakisch-ungarischen Mischpartei Most’-Híd gestellten Vizepremiers Rudolf Chmel zustande kam, sieht auf kommunaler und regionaler Ebene einen Volksgruppenanteil von 15 (statt bis dato 20) Prozent vor. Der Pferdefuß dabei: Sie gilt allerdings nur dort, wo dieser Anteil in zwei Volkszählungen bestätigt worden ist, deren nächste erst 2021 stattfindet. Womit daher faktisch das alte, restriktive Sprachengesetz noch immer in Kraft ist.
Staatsbürgerschaft für Volksangehörige im Ausland
Vice versa ist jenes ungarische Gesetz strittig, das die Staatsbürgerschaft auch Personen erteilt, die keinen dauerhaften Wohnsitz in Ungarn haben. Hauptzielgruppe sind die mehr als zwei Millionen Magyaren in den Nachbarländern, Nachfahren jener Trianon-Ungarn, die infolge des Friedensvertrags von 1920 zu Minderheiten wurden: in Rumänien (1,4 Millionen), in der Slowakei (550. 000), in der (Karpato-)Ukraine (150.000), in Serbien (290.000), Kroatien (17.000), Slowenien (8.000) und Österreich (40.000 Muttersprachler, laut Volkszählung 6.500).
Das ungarische Staatsbürgerschaftsgesetz, novelliert mit Zustimmung aller im Parlament vertretener Parteien – bei nur drei Gegenstimmen aus den Reihen der Sozialisten –, ist umstritten in der EU. Doch mit keinem anderen Nachbarstaat außer der Slowakei liegt Ungarn wegen dieses Gesetzes in ernsthaftem Streit, nicht einmal mit Rumänien. Im Gegenteil: Bukarest verfolgt in der Staatsbürgerschaftsfrage dieselbe Politik und lässt ethnischen Rumänen, die in der benachbarten Republik Moldova zwei Drittel der Gesamtbevölkerung (knapp 4 Millionen) stellen, die rumänische zuteilwerden.
Rumänien will Magyaren-Anteil in Regionen verwässern
Doch auch über dem rumänisch-ungarischen Verhältnis, das sich mit Amtsantritt der Regierung Orbán unerwartet spannungsfrei gestaltete und von einem zuvor ungekannten Kooperationsgeist gekennzeichnet war, sind wieder Wolken aufgezogen. Ursache: Entgegen allen offiziellen Verlautbarungen aus Bukarest setzt Rumänien vor allem den ethnischen Ungarn im Lande zu, insbesondere dort, wo die der Zahl nach größten magyarischen Bevölkerungsanteile zu verzeichnen sind: im Kreis Mureș immerhin 40 Prozent, im Kreis Covasna (Kovászna) 74 und im Kreis Harghita sogar 85 Prozent. Bukarest plant Makroregionen, womit die traditionellen Siedlungsgebiete der Magyaren zerschnitten und hauptsächlich auf die Nordwestregion Someșana, die Westregion Apușeana und die Zentralregion Mureșana aufgeteilt würden. Folge: Die ethnische Zusammensetzung würde damit so sehr verkehrt, dass selbst die bisher in Mehrheitsposition befindlichen Székler in ihren kompakten Siedlungsgebieten (Székelyföld) in die Minderheit gerieten.
Trotz aller sonstigen politischen Zwietracht wissen sich die rumänischen Ungarn-Verbände und Ungarn-Parteien darin einig, dass die Verwirklichung des rumänischen Vorhabens auf Assimilation der Magyaren hinausliefe – ein Ziel, das nahezu alle Regierungen Rumäniens seit Trianon verfolgten. An den etwa 60 000 Csángos, der vornehmlich im Kreis Bacău beheimateten altungarischen Minderheit katholischen Bekenntnisses in gänzlich orthodoxem Umfeld zeigt sich seit vier Generationen, was Assimilierung bedeutet: allmähliche Verschmelzung mit der Staatsnation.
Missachtung geltenden Minderheitengesetzes
In Siebenbürgen gibt ein weiterer Vorgang seit Wochen Anlass zu Besorgnis. So wies Zsolt Árus vom Nationalrat der Székler mehrfach auf Fälle hin, in denen ein in Bukarest eingetragener „Verein für Bürgerrechte“ ungarische Bürgermeister im Széklerland dazu aufforderte, ungarische Aufschriften an Gemeindehäusern und Kommunaleinrichtungen ebenso zu entfernen wie Traditionssymbole der Minderheit, wie beispielsweise der Székler-Flagge. Folgen Bürgermeister dem nicht, werden sie von besagtem Verein verklagt. Für 2016 waren 59 solche Fälle zu verzeichnen gewesen. In aller Regel entscheidet die rumänische Justiz erst- und zweitinstanzlich zugunsten des klagenden Vereins. Wenngleich im geltenden rumänischen Minderheitengesetz festgelegt ist, dass bei einem Anteil von 20 Prozent Minderheitenangehörigen an der Gesamtbevölkerung zweisprachige Ortsschilder und Aufschriften vorhanden sein müssen.
Dennoch wird vielfach gegen diese Norm verstoßen. Dort nämlich, wo es solche zweisprachigen Schilder gibt, wird nicht selten just der ungarische Ortsname beschmiert oder gänzlich unkenntlich gemacht. So unlängst in Maroshévíz/Toplița (deutsch: Töplitz) im Kreis Harghita, wie sowohl der Székler-Nationalrat, als auch der Demokratische Verband der Magyaren Rumäniens (RMDSz) bekanntgaben. Dabei war es erst kurz zuvor dem ungarischen Bevölkerungsteil in der 13.000-Einwohner-Stadt nach jahrelangen Auseinandersetzungen gelungen, den Bürgermeister davon zu überzeugen, zweisprachige Ortsschilder aufzustellen. Wie aus dem RMDSz verlautete, handele es sich „nicht um Dummejungenstreiche“, denn die Schilder seien an allen Stadtein- und -ausfahrten mit derselben Farbe beschmiert worden. Im Übrigen gebe es in ganz Siebenbürgen dieselben Vorkommnisse, was von einer latent anti-ungarischen Haltung im rumänischen Bevölkerungsteil zeuge. Ignoranz und Untätigkeit der rumänischen Behörden, insbesondere der Gemeindeverwaltungen sowie der Polizei, zeige sich unter anderem daran, dass es noch nie zur Identifizierung der Täter gekommen sei und die kommunalen Instanzen stets alle zur Verfügung stehenden Tricks anwendeten, um zweisprachige Aufschriften überhaupt zu verhindern.
In Rumänien wird damit klar gegen das von Bukarest 1998 ratifizierte Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten verstoßen. Indes sind sich Bukarest und Budapest weitgehend einig, wenn es um die Interessen ihrer jeweiligen Minderheiten in der Karpato-Ukraine geht. Dort stellen die Magyaren mit 151.000 Personen zwölf und die 32.000 ethnischen Rumänen 2,6 Prozent der Bevölkerung.
Serbien schob Ungarn Kollektivschuld zu
Einem gedeihlichen serbisch-ungarischen Nachbarschaftsverhältnis stand einst das unter Serbiens vormaligem Präsidenten Boris Tadić erlassene Restitutionsgesetz entgegen, welches am Kollektivschuld-Prinzip festhielt und daher Nachfahren vertriebener Volksdeutscher und Magyaren von der Entschädigung für enteignetes Hab und Gut ausschloss. Der damalige ungarische Außenminister János Martonyi hatte daher unumwunden angekündigt, Budapest werde sein Veto einlegen, wenn im Europäischen Rat über den EU-Kandidatenstatus für Serbien befunden werde, sollte Belgrad das Gesetz, das er „moralisch, rechtlich und politisch unannehmbar“ nannte, belassen wie es war. Daraufhin wurde es im Belgrader Parlament mit großer Mehrheit novelliert und damit den Budapester Einwänden Rechnung getragen, womit sich nicht nur das Nachbarschaftsverhältnis besserte, sondern Ungarn sich – zusammen mit mehreren Nachbarstaaten – für die Erteilung des EU-Kandidaten-Status aussprach.
Keine Probleme mit Kroatien
Dagegen spielt(e) im Verhältnis Budapests zu Zagreb die Minderheitenfrage kaum eine Rolle. Seit 2002 ist das kroatische Verfassungsgesetz über den Schutz der Minderheiten in Kraft, und 2003 konnten ihre Selbstverwaltungen gewählt werden. Im benachbarten Slowenien verfügen die 8.000 ethnischen Ungarn sogar über ein in der Verfassung verankertes Viril-Mandat.
Irritation über Österreich
Irritiert war man wegen der Minderheiten-Frage in Budapest hingegen von Österreich. Der Vorwurf: Die ungarische sei ebenso wenig wie die kroatische Minderheit des Burgenlandes in Verhandlungen über die Novellierung des Volksgruppengesetzes eingebunden gewesen, welche nach der Einigung mit den Kärntner Slowenen über die Zahl zweisprachiger Ortsschilder in Erfüllung des Artikels 7 des österreichischen Staatsvertrags von 1955 im Vorjahr – 56 Jahre nach dessen Inkrafttreten – nötig war. Dass Gemeinden mit Minderheitenanteil aufgrund einer neuen Amtssprachenregelung behördliche Vorgänge, welche auch in den Minderheitensprachen zum Ausdruck gebracht werden müssen, an die Bezirkshauptmannschaften als nächst höhere Instanz delegieren dürfen und so Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch „amtswegig entsorgt“ werden könnten, befürchte(te)n nicht allein das Österreichische Volksgruppenzentrum (ÖVZ) in Wien, sondern auch Budapest und die Interessenvertretungen der Magyaren im Lande.
Südtirol als Beispiel für Entschärfung derartiger Konflikte
Selbst wenn man sich nur die wenigen Beispiele dieses kursorischen Überblicks ins Bewusstsein ruft – es gibt deren weit mehr! –, so kann im Zusammenhang mit historischen Minderheitenkonflikten, welche in der aktuellen Nachbarschaftspolitik fortwirken, ja sie oft dominieren, nicht oft genug als Vorbild für deren Entschärfung, ja sogar als Vorbild für ihre Beseitigung und Lösung das Beispiel Südtirol vor Augen geführt werden. Insbesondere wenn es sich um Auseinandersetzungen zwischen Nachbarstaaten handelt, die auch noch EU-Mitglieder sind, wie zwischen Ungarn und der Slowakei sowie Rumänien.
Gerade am Beispiel Südtirols lässt sich vorführen, dass national(kulturell)e Zusammengehörigkeit und Einheit sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit möglich sind und mit Erfolg, auch und gerade wirtschaftlichem, praktiziert werden, ohne nationalstaatliche Grenzen zu verschieben. EU-Mitgliedschaft und gelebter Regionalismus haben just die 1918/19 mit der Teilung Tirols zwischen Österreich und Italien aufgerichteten und nach 1945 beibehaltenen Grenzen weitgehend überwinden lassen, wenngleich sie naturgemäß faktisch und administrativ weiter bestehen.
Um diesen „Modell“-Charakter vor Augen zu führen, ist an dieser Stelle ein gestraffter historischer Exkurs notwendig. Nach dem Ersten Weltkrieg war der südliche Teil Tirols im Friedensvertrag von St.-Germain-en-Laye 1919 Italien zugeschlagen worden, das ihn zuvor waffenstillstandswidrig annektiert hatte. Als das faschistische Italien vom Oktober 1922 an („Marsch auf Rom“) danach trachtete, das „Hochetsch“ („Alto Adige“ gemäß damals verordneter Benennung) zu entnationalisieren, indem es
- >> den Namen Tirol verbot;
- >> alle Namen (selbst auf Grabsteinen) italianisiert wurden;
- >> kein Deutschunterricht mehr erteilt werden durfte;
- >> in der Öffentlichkeit nicht deutsch gesprochen werden durfte;
- >> die Orts- und Talschaftsmundarten, mithin der Dialekt, verboten war;
- >> Italienisch alleingültige Amtssprache wurde;
- >> alle österreichischen Verwaltungsbeamten durch italienische und
- >> alle gewählten Bürgermeister durch per Dektret eingesetzte italienische Amtsbürgermeister (Podestà) ersetzt und
- >> Italiener aus Süditalien nach Südtirol umgesiedelt wurden;
und all diese kolonialistischen Zwangsmaßnahmen nicht den erwünschten Erfolg zeitigten, zwangen (die Achsenpartner) Hitler und Mussolini die Südtiroler mittels eines „Options“-Abkommens, sich entweder für das Deutsche Reich zu entscheiden (und über den Brenner zu gehen) oder in ihrer Heimat zu verbleiben (und damit gänzlich italienisiert zu werden).
Zweifelhafter Minderheitenschutz durch Gruber-De Gasperi-Abkommen
Obschon die meisten für Deutschland optierten, verhinderte der Zweite Weltkrieg die kollektive Umsiedlung. 1946 lehnten die Alliierten die Forderung nach einer Volksabstimmung in Südtirol ab, woraufhin sich in Paris die Außenminister Österreichs und Italiens auf einen Minderheitenschutz für die Südtiroler verständigten, der Bestandteil des Friedensvertrags mit Italien wurde. Das Gruber-de-Gasperi-Abkommen vom 5. September 1946 sah die politische Selbstverwaltung vor, und im Kulturellen wurden muttersprachlicher Unterricht sowie die Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache auf allen Feldern des gesellschaftlichen Lebens garantiert.
„Los von Trient!“
Zwar erließ Rom 1948 vertragsgemäß ein Autonomie-Statut und deklarierte es – wie zwischen Vertragspartnern und Siegermächten verabredet – zum Bestandteil der italienischen Verfassung. Allerdings wurde die Provinz Bozen-Südtirol mit der Nachbarprovinz Trient in einer Region („Trentino – Alto Adige“) zusammengefasst, ein Trick des Trientiners Alcide De Gasperi, der zur Majorisierung der deutschen und der ladinischen Volksgruppe durch die italienische führte, die im Trentino absolut dominant war. Dagegen und gegen die gezielte Ansiedlung weiterer Italiener zwischen Brenner und Salurner Klause protestierten die Südtiroler 1957 unter der Parole „Los von Trient“. Mit Bombenanschlägen, von denen man heute weiß, dass dabei auch italienische Geheimdienste zur Erzeugung einer „Strategie der Spannung“ die Finger im Spiel hatten, machte der „Befreiungsausschuss Südtirol“ (BAS) die Welt auf die uneingelösten vertraglichen Zusicherungen Roms aufmerksam.
1960 trug der damalige österreichische Außenminister Bruno Kreisky den Konflikt vor die UN. Italien lenkte trotzdem nicht ein, woraufhin die Anschläge im Sommer 1961 ihren Höhepunkt erreichten, Rom 21.000 Soldaten und Carabinieri in den Norden verlegte und Südtirol auch international in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rückte, woran sich heute außer der Erlebnisgeneration und Historikern kaum noch jemand erinnert.
Nur knappe SVP-Mehrheit für zweites Statut
Nach etlichen Verhandlungsrunden zwischen Wien und Rom im Beisein von Vertretern Nord- und Südtirols einigt man sich auf die Entschärfung des Konflikts, indem man 137 Einzelmaßnahmen an einen „Operationskalender“ band – einer zeitlichen Vorgabe für die Umsetzung – und in einer beispielgebenden „Paket-Lösung“ verschnürte. Bevor diese am 20. Januar 1972 als „Zweites Autonomiestatut“ in Kraft treten konnte, musste ihm die Südtiroler Volkspartei (SVP), die seinerzeit maßgebliche politische Kraft der deutschen und ladinischen Volksgruppe, zustimmen; wobei auf deren Parteitag in der Kurstadt Meran 1969 nur eine knappe Mehrheit dafür zustande kam.
Und es sollte weitere zwanzig Jahre dauern, bis die wesentlichen Bestimmungen über die Selbstverwaltung sowie die tatsächliche Gleichstellung der deutschen Sprache verwirklicht werden konnten. So dass am 30. Januar 1992 das „Paket“ für erfüllt erklärt werden konnte, nachdem der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti im römischen Parlament die Zusicherung gegeben hatte, dass Änderungen daran nur mit Zustimmung der Südtiroler vorgenommen werden dürften.
Offizielle Streitbeilegung erst 1992
Es folgte ein diplomatischer Notenwechsel zwischen Rom und Wien sowie schließlich am 11. Juni der formelle Abschluss des Südtirol-Konflikts durch Abgabe der „Sreitbeilegungserklärung“ vor den Vereinten Nationen. Mit dem Beitritt Österreichs zur EU 1995 und mit Inkrafttreten des Schengen-Abkommens fiel das Grenzregime am Brenner-Pass und anderen Übergängen, womit die beiden Teile Tirols wieder näher zusammenrückten als je zuvor seit der Annexion Südtirols 1918.
Nicht zu unterschätzen sind just die wirtschaftlichen Vorteile, welche der grenzüberschreitende Regionalismus bietet, in den das österreichische Bundesland Tirol, die italienische Autonome Provinz Bozen-Südtirol sowie die Autonome Provinz Trient als die beispielgebenden drei Landesteile des „Alten Tirol“ eingebunden sind. Noch vor 50 Jahren war Südtirol ein armes Land, mittlerweile ist es ein reiches. Heute beträgt sein (gänzlich eigenfinanzierter) Provinzhaushalt sechs Milliarden Euro – bei einer Bevölkerung von 530 000 Menschen auf 7400 Quadratkilometern Fläche, von der wegen der Lage in den Zentralalpen gerade einmal 15 Prozent bewirtschaftungsfähig sind. 90 Prozent des Steuer- und Abgabenaufkommens verbleiben in der Provinz, zehn Prozent werden gemäß Autonomie-Paket an das italienische Staatsbudget abgeführt. Diese autonome Form der regionalen Selbstverwaltung führte also zu Wohlstand und Stabilität, beides liegt im Interesse von Staatsnation – in Südtirol der italienischen Volksgruppe – und Minoritäten.
Engeres Zusammenrücken
Wenngleich (noch) nicht vollkommen, rückt die Europaregion Tirol – oder „Tiroler Euregio“ –, in der die drei Landesteile (österreichisches Bundesland Tirol; autonome italienische Provinzen Bozen-Südtirol und Trient, zusammengefügt in der autonomen Region Bolzano-Alto Adige) seit den 1990er Jahren organisatorisch zusammenarbeiten, allmählich auch politisch enger zusammen. Es bleibt zu hoffen, dass dieses „Modell“ – trotz immer wieder von Rom ausgehender Maßnahmen, die Autonomie wenn nicht zu untergraben so doch zu beschneiden – seine wünschenswerte Wirkung auf andere schwelende Volksgruppenkonflikte nicht verfehlt.
Jeder an positiven Beispielen der Nationalitätenpolitik und des Minderheitenschutzes Geschulte weiß, dass die trotz Grundlagenvertrags zwischen den beiden Donau-Anrainern Ungarn und Slowakei obwaltenden Umstände sowie das von der Minderheitenfrage nach wie vor bestimmte Verhältnis zwischen Ungarn und Rumänien hinter dem alltäglichen Dasein vertraglich geschützter Minderheiten weit zurückbleiben: etwa im Vergleich mit den Schweden auf den zu Finnland gehörenden Åland-Inseln; oder mit der deutschen Volksgruppe in Süddänemark, respektive der dänischen in Schleswig-Holstein; auch mit der Deutschen Gemeinschaft in Ostbelgien; ganz zu schweigen mit den altösterreichischen Deutschtirolern und Ladinern (Nachfahren der rätischen Urbevölkerung) in der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol.
Staatsnationen und ethnische Minderheiten
Auch nach der systemischen Zäsur 1989/90 konnte trotz löblicher Versuche und gewisser rechtlicher Übereinkünfte – vornehmlich im Europarat – die Sprengkraft, die im Verhältnis zwischen Staatsnationen und ethnischen Minderheiten – zuvörderst in Zentralstaaten – steckt, noch lange nicht und vor allem nicht überall gebändigt werden. Das muss angesichts von rund 350 autochthonen Minderheiten mit mehr als 100 Millionen Angehörigen, einem Siebtel der Bevölkerung in den Staaten zwischen Atlantik und Ural, in denen sie beheimatet sind, umso mehr verstören, als sich die Europäische Union (EU) kein wirksames Instrumentarium oder einen Operationsmechanismus geschaffen hat, Minderheitenkonflikte nicht nur einzudämmen, sondern gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen. Im Gegenteil: EU-Kommission und Rat schauen eher merkwürdig unbeteiligt zu, erklären sich für „unzuständig“ oder geben beschämend anmutende Empfehlungen ab, wonach beteiligte Konfliktparteien ihren Streit gefälligst „bilateral regeln“ mögen.
Die EU ist gefordert
Das geht an der Wirklichkeit vorbei. Womit wir noch einmal bei Südtirol sind. Was lässt sich aus dessen Entwicklung – gekennzeichnet von jahrzehntelangem, bisweilen dramatischem Kampf um territoriale und kulturelle Autonomie sowie politische Selbstverwaltung – angesichts der heute weithin geltenden Einschätzung, wonach es sich um einen „Modellfall“ mit „Vorbildcharakter für die friedliche Lösung anderer Minderheitenkonflikte“ handele, ableiten? Nichts weniger, als dass EU-Kommission und Rat dafür sorgen müssten, Repräsentanten aller politischen Ebenen von Staatsnationen und Minderheiten-Vertretern so oft wie möglich dorthin zu bringen, damit sie das Neben- und Miteinander von Deutschen (Anteil 69,2 Prozent), Ladinern (4,4 Prozent) und Italienern (26,4 Prozent) trotz aller Unvollkommenheit und des nicht nachlassenden Versuchs der italienischen Politik, die Autonomie wo es nur irgend geht zu beschneiden, studieren könnten.
Insbesondere National-Slowaken und -Rumänen würden anschaulich erfahren und erleben, dass (das Verlangen nach) Autonomie – sei sie territorial, sei sie kulturell – keinesfalls jenen Schreckbildern entspricht, welche sie in ihrer Heimat davon zeichnen.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com