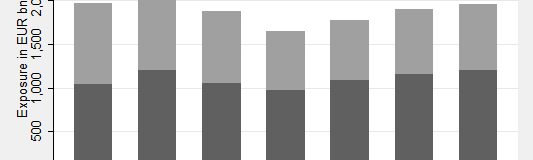Geld bleibt billig. Dieses klare Signal ging dieser Tage von der Fed aus. Und auch die EZB dürfte sich weiterhin an der Liquiditätsflutung der Märkte beteiligen. Die Folgen werden vielfach unterschätzt. Die schleichende Enteignung der Sparer wäre schon schlimm genug. Zudem bilden sich aber gefährliche Blasen. Die Notenbanker fürchten offenbar den Zeitpunkt, da die Politik des billigen Geldes zu Ende geht. Doch warum eigentlich? Wissen sie mehr als die Marktteilnehmer?
[[image1]]Ein positives Urteil der deutschen Stiftung Warentest erweist sich für die jeweiligen Hersteller oder Dienstleister als außerordentlich verkaufsfördernd. Doch wenn die Unternehmen künftig mit dem Testurteil und dem Original-Logo der Berliner Stiftung werben möchten, wird es richtig teuer. Zwischen 7.000 und 15.000 Euro müssen sie dann dafür pro Jahr berappen. Offiziell will die Stiftung mit diesem Geld weitere Tests finanzieren. Doch der eigentliche Grund dürfte etwas mit der aktuellen Politik des billigen Geldes zu tun haben. Wegen der geringen Renditen für konservative Geldanlagen sind die Kapitalerträge der Stiftung offenbar deutlich gesunken, weshalb man sich nun nach alternativen Einnahmequellen umschaut.
Dies ist weder ein Einzelfall noch ein deutscher Sonderfall. Stiftungen, eigentlich ein wichtiges Instrument bürgerschaftlichen Engagements in Zeiten knapper Staatsfinanzen, werden mehr und mehr zu Opfern der ultralockeren Geldpolitik. Für Stiftungen sei es eine große Herausforderung, „ihre Effektivität aufrecht zu erhalten oder gar zu steigern“, stellte unlängst Lutz Stratmann, Vorsitzender des Kuratoriums der Volkswagen-Stiftung, fest. Das gilt gleichermaßen für deutsche wie für österreichische Stiftungen. Dem guten Zweck kommen nämlich nur die Erträge aus dem Stiftungskapital zugute. Und dieser Kapitalstock liegt bei rund 74 Prozent aller Stiftungen unter einer Million Euro. Angesichts des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus kann man damit sicher keine großen Sprünge machen.
Sparer stellen die Sinnfrage
Wenn über die Risiken und Nebenwirkungen der Billig-Zins-Politik diskutiert wird, ist schnell die Rede von einer schleichenden Enteignung der Sparer. Und dies ist in der Tat der augenfälligste Aspekt. Bei einer Inflationsrate im Euro-Raum von etwa 1,5 Prozent und einem Sparzins unter einem Prozent lohnt sich das klassische Sparen nicht mehr. Schon warnen Banken, selbst in Deutschland und Österreich, wo es zu den bürgerlichen Tugenden gehört, etwas „auf die hohe Kante zu legen“, stellten immer mehr Kunden die Sinnfrage: Weshalb soll man sein Geld auf ein Sparkonto einzahlen, wenn man damit Verluste einfährt?
Aber die Folgen der lockeren Geldpolitik erscheinen noch weitreichender. Die stark rückläufigen Mittel kleinerer Stiftungen sind hierfür nur ein Beispiel. Weitaus besorgniserregender nehmen sich die Gefahren von zunehmenden Fehlallokationen aus. Sprich: Kapital fließt in rauen Mengen in bestimmte Anlageformen, was die Preise geradezu explodieren lässt. Trotzdem hält der Zustrom von Liquidität an – es bilden sich gefährliche Blasen.
Besonders deutlich wird dies derzeit auf den Immobilienmärkten, und zwar nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern vor allem im Nicht-EU-Land Schweiz. Die dort seit Jahren explodierenden Immobilienpreise alarmierten jetzt sogar die Schweizer Nationalbank (SNB). Die eidgenössischen Notenbanker mahnen zur Vorsicht und warnen vor leichtfertiger Kreditvergabe.
Anlass zu derlei Mahnungen und Warnungen besteht denn auch allemal. Innerhalb von nur zehn Jahren haben sich die durchschnittlichen Preise für Eigentumswohnungen in Zürich nahezu verdoppelt. Für eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 125 Quadratmetern müssen in der Schweizer Finanzmetropole schon mal bis zu einer Million Euro gezahlt werden. Wer’s nicht kann, nimmt zu Mini-Zinsen ein Darlehen auf. „Der leichte Zugang zu Krediten wirkt wie eine Einladung, ich würde sogar sagen, wie eine Falle“, warnt SNB-Vizepräsident Jean-Pierre Danthine.
Eidgenössische Pulverfässer
Doch den Schweizer Nationalbankern sind die Hände gebunden. Unter normalen Umständen hätten sie schon längst die Leitzinsen anheben müssen. Angesichts der extrem niedrigen Zinsen in der EU, in den USA und anderen wichtigen Wirtschaftsnationen würde ein solcher Schritt den Schweizer Franken jedoch massiv unter Aufwertungsdruck setzen.
Um die Entstehung gefährlicher Blasen zu verhindern, vergeben die eidgenössischen Banken seit gut einem Jahr nur noch Baudarlehen, wenn der Kunde mindestens zehn Prozent Eigenkapital nachweisen kann. Außerdem müssen Banken ab dem 1. Oktober Hypothekenkredite zusätzlich mit einem Prozent Eigenkapital unterlegen. Ob dies ausreicht, eine Blasenbildung zu verhindern, erscheint ungewiss.
Doch nicht nur in der Schweiz könnte sich die Niedrigzins-Politik als Immobilien- und Finanzierungsfalle erweisen. „Viele Kunden kaufen Objekte, die sie sich normalerweise gar nicht leisten können. Spätestens bei der Anschlussfinanzierung in 10 oder 15 Jahren könnte sich die bis dahin kaum entschuldete Immobilie als existenzbedrohendes Pulverfass erweisen, zumal immer mehr Kunden zu 100 Prozent finanzieren“, sagte der Leiter der Baufinanzierung einer Frankfurter Bank dieser Tage in einem vertraulichen Gespräch.
Bleibt als Alternative noch der Aktienmarkt. Doch auch dort tun sich sonderbare Dinge. Als die US-Notenbank Fed jetzt ankündigte, auch in Zukunft monatlich amerikanische Staatsanleihen von 85 Milliarden Dollar aufzukaufen, haussierten die Börsen weltweit. In vielen Ländern erreichten die Aktien-Indices neue Allzeithochs. Sogar die Aktien von Unternehmen, die tief in der Krise stecken, legten zu. Das zeigt: Die Hausse hat sich losgelöst von Fundamentaldaten und wird von einem Liquiditäts-Tsunami nach oben gespült. Innerhalb von rund zwei Jahren ist der deutsche Aktienindex Dax um rund 60 Prozent gestiegen, die Gewinne der Unternehmen legten aber lediglich um etwa zehn Prozent zu.
Die Alternative: Cash oder Crash
Nach der Entschärfung der Bankenkrise hieß es von vielen Regierungen, es dürfe nie mehr eine Situation eintreten, in der die Banken Staaten erpressen könnten – nach dem Motto: Cash oder Crash. Nun sind es die Märkte, die sogar die Notenbanken unter Druck setzen. Schon leise Ankündigungen über ein allmähliches Ende des billigen Geldes reichen aus, um Turbulenzen an den Märkten auszulösen. Da nicht davon auszugehen ist, dass die EZB eine andere Strategie verfolgt als die mächtigste Notenbank der Welt, dürfte die Party an den Börsen noch eine Weile weitergehen.
Es sei denn, die Marktteilnehmer werden allmählich nachdenklich. Wieso deutet die Fed zunächst eine Reduzierung der Anleihenkäufe an, um dann weiterzumachen wie bisher? Wie stabil ist die US-Konjunktur wirklich? Wieso berichtet die EZB von Fortschritten in den Euro-Krisenländern einschließlich Griechenland, um dann keinen Zweifel daran zu lassen, dass die Zinsen künstlich niedrig bleiben werden? Was wissen die Zentralbanken möglicherweise, was andere Marktteilnehmer nicht wissen? Erleben wir vielleicht noch in diesem Jahr dramatische Bankenpleiten in China? Dann allerdings müssten sich die Börsianer warm anziehen. Und all jene, die in der seit Monaten anhaltenden Schwächephase des Goldes auf das gelbe Edelmetall gesetzt haben, könnten sich die Hände reiben.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com