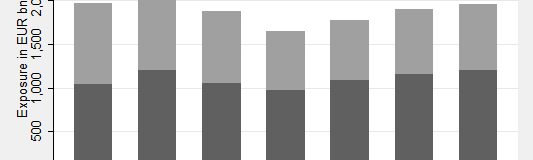Die EZB will künftig transparenter kommunizieren und ihre Sitzungsprotokolle anonym veröffentlichen. An der (un)heimlichen Macht am Main wird dies nichts ändern. EZB, Fed & Co. haben nur ein Ziel – trotz gigantischer Staatsschulden einen Bankrott zu verhindern. Zahlen müssen dafür die Sparer. Denn negative Realzinsen bedeuten nichts anderes als eine Umverteilung vom Sparer zum Schuldner.
[[image1]]Parlamentswahlen sorgen an den Finanzmärkten normalerweise nur in Ausnahmefällen für Aufmerksamkeit. „Politische Börsen haben kurze Beine“, heißt es dann in der Regel. Im Klartext: Selbst ein Regierungswechsel wirkt sich allenfalls kurzfristig positiv oder negativ auf die Märkte aus, weil sich längerfristig ohnehin wenig bis gar nichts ändert. Bei Parlamentswahlen geht es kaum noch um den Wettbewerb von Alternativen, sondern zunehmend um Nuancen und Varianten.
Im Zeichen der Euro-Schuldenkrise aber kommt Wahlen sowohl in den Krisenstaaten als auch in den Geberländern wieder erhöhte Aufmerksamkeit zu. Droht eine Regierungskrise in Portugal, wirkt die fragile Regierung in Italien angeschlagen, erscheint die Zukunft des spanischen Premiers ungewiss und muss die Regierung in Athen um ihre hauchdünne Mehrheit fürchten, dann kehren die Ängste und Sorgen recht schnell an die Märkte zurück. Und den Marktteilnehmern wird die bisweilen gern verdrängte Tatsache wieder gewahr, dass bisher kein Problem wirklich gelöst, sondern bestenfalls entschärft wurde.
Wer Regierungen stützt und stürzt
Die zumindest kurzfristig aufflackernde Nervosität bei drohender politischer Instabilität ist freilich nicht ganz nachvollziehbar. Denn letztlich ist es ziemlich egal, ob Konservative, Liberale, Sozialdemokraten oder Grüne (mit)regieren. Das Lagezentrum zur Kontrolle der Eurokrise hat sich längst nach Frankfurt zur EZB verlagert. Und Mario Draghi scheint sich in der Rolle des mächtigsten Mannes der EU zu gefallen. Die Macht der Notenbank ist riesig. Sie jongliert mit Billionen-Summen, drückt künstlich das Zinsniveau, um die Krisenstaaten vor der endgültigen Pleite zu retten, und sie kann zumindest indirekt Regierungen stürzen oder stützen. Silvio Berlusconi stürzte nicht über die zerstrittene italienischen Opposition und auch nicht über die Justiz. Sein Schicksal war besiegelt, als Ende 2011 die Risikoprämien für italienische Staatspapiere in die Höhe schossen und die EZB ungerührt zuschaute.
Man kann diese Machtfülle der EZB natürlich pragmatisch werten. Keine andere Institution verfügt über ähnlich wirksame Instrumente, um einen Währungscrash zu verhindern. Außerdem sprangen die Notenbanker im Allgemeinen und Mario Draghi im Besonderen ein, als erkennbar war, dass die Regierungen die Euro-Krise nicht würden entschärfen können. Aber man kann (und muss vielleicht sogar) die Frage stellen, ob es wirklich vertretbar erscheint, dass Notenbanker, die sich bekanntlich keiner demokratischen Wahl stellen müssen, hochriskante Strategien einsetzen, deren Folgen derzeit noch keiner abzuschätzen vermag.
Die Frage stellt sich vor allem deshalb, weil die Macht der Notenbanker nicht nur für kurzfristiges Krisenmanagement eingesetzt wird, sondern ihre Maßnahmen Langzeitwirkung entfalten. Mittels negativer Realzinsen findet ein Geldtransfer vom Sparer zum Schuldner statt. Keine Frage, die Sparer werden Geld verlieren, denn negative Realzinsen kommen in ihrer Wirkung einer heimlichen und ebenfalls demokratisch nicht legitimierten Steuer gleich. Anleger können sich dem zwar entziehen, indem sie in Sachwerte umschichten, doch dann laufen sie Gefahr, in die nächste Immobilien- oder Aktienblase zu investieren. Ein Ende der finanziellen Repression ist derweil nicht absehbar. Erst vor wenigen Tagen kündigte Mario Draghi eine Fortsetzung der Niedrigzinspolitik an, bis sich die Konjunktur in der Euro-Zone nachhaltig erhole. Wie er eine „nachhaltige Erholung“ definiert, ließ der EZB-Chef offen. Die Krisenstaaten wird es freuen, für die Sparer waren das keine guten Nachrichten, die Draghi vor dem Aufbruch in seinen Sommerurlaub überbrachte.
Waghalsige Finanzierungen
Bislang bestimmten die Notenbanken mit ihren Leitzinsen in erster Linie die Zinshöhe am „kurzen Ende“, sprich: am Geldmarkt. Die Zinskosten für mittel- und langfristige Darlehen hingegen bilden sich normalerweise weitgehend am Markt, wobei den Zinssätzen für Staatsanleihen besondere Bedeutung zukommt. Durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen oder die Ankündigung, dies im Fall der Fälle unbegrenzt zu tun, beeinflussen die Notenbanken nun aber auch das Zinsniveau am „langen Ende“. Die Krisenstaaten profitieren, denn ihre Bonds sind faktisch mit einer EZB-Garantie ausgestattet. Die Folge: niedrige Zinsen infolge sinkender Risiken.
Über sehr günstige Zinsen im langfristigen Bereich freuen sich natürlich auch Bauherren und Immobilienkäufer, doch Kapitalmarktzinsen etwa in Höhe der Inflationsrate verführen zu waghalsigen Finanzierungen. Häufig werden die niedrigen Zinsen nicht für eine höhere Tilgung, sondern für den Erwerb einer teureren (möglicherweise überteuerten) Immobilie genutzt. Spätestens bei der Anschlussfinanzierung in einigen Jahren folgt dann das böse Erwachen. Sogar die scheinbar verbraucherfreundlichen Aspekte der Billiggeld-Politik bergen also erhöhte Risiken.
Die Notenbanker seien keine Währungshüter mehr, schreibt der deutsche Wirtschaftspublizist Daniel D. Eckert in seinem neuen Buch[1]. Heute müssten sie die Schwungräder der Wirtschaft am Laufen halten und die Staaten fortwährend mit frischem Geld versorgen. Die Verschuldung der Industrienationen sei inzwischen so hoch, dass nur noch manipulierte, künstlich gedrückte Zinsen den Staat vor der Pleite bewahren könnten.
Und dabei genießt die EZB nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Selbst die höchsten Gerichte haben kaum noch etwas mitzureden. Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang die Einschätzung des früheren Präsidenten des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der dieser Tage in einem Interview erklärte: „Die EZB kann nicht von einem nationalen Gericht zu einem Tun oder Unterlassen verurteilt werden“.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com