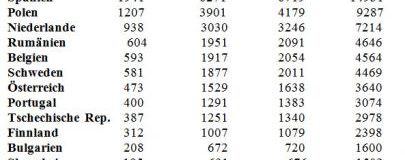Endlich ist sie zu Ende gegangen, die sommerliche Lethargie im Brüsseler EU-Hauptquartier. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und seine Kommissarinnen und Kommissare haben, hoffentlich bestens erholt, ihre Arbeit wieder aufgenommen, um weiterhin an zahlreichen offenen Problemen zu tüfteln.
Am Mittwoch, dem 2. September, absolvierte das hohe Kollegium ein gemeinsames Seminar, bei dem die derzeit wichtigsten Themen im Mittelpunkt standen – allen voran die Flüchtlingsproblematik, jenes Megathema, bei dem gar nichts weiterzugehen scheint.
Kurz zuvor hat Unions-Boss Juncker in einem etwa in der deutschen „Welt“ und im französischen „Le Figaro“ erschienenen Artikel die einschlägigen Initiativen – besser wäre wohl: „Initiativen“ – seiner Kommission wortreich erläutert. Er erinnerte darin an seine im Mai präsentierten Vorschläge für eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU, verwies stolz auf das Faktum, dass die Gemeinschaft ihre Präsenz im Mittelmeer, wo sich laufend Boots-Tragödien mit zahlreichen Toten ereignen, verdreifacht hat. Oder dass die Brüsseler Institutionen, darunter Frontex, EASO oder Europol, die am schwersten betroffenen Mitgliedsstaaten beim Ansturm der Flüchtlinge unterstützen. Oder dass die Union fest entschlossen sei, exponierte Länder wie Griechenland nicht allein zu lassen, sondern ihnen abgesehen von Solidarität auch finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Oder dass die Kommission es geschafft hat, 32.000 Asylsuchende auf mehrere EU-Staaten aufzuteilen – was allerdings im Hinblick auf die 50.000 Menschen, die allein im Juli nach Griechenland oder die 35.000, die im selben Zeitraum nach Ungarn gekommen sind, bloß einem Tropfen auf den heißen Stein gleichkommt.
Juncker im O-Ton: „Was wir brauchen und was uns leider noch fehlt, ist der kollektive Mut, um unsere Ziele anzupeilen und zu erreichen – auch wenn das nicht leicht und nicht immer populär ist“. Und weiter: „Ich hoffe, dass wir gemeinsam beweisen können, den Herausforderungen, die vor uns liegen, gerecht zu werden“.
Mit ähnlichen Formulierungen – man könnte auch sagen: leeren Floskeln – reagierte Brüssel auf die 71 Todesopfer, die kürzlich in einem Schlepper-Lkw im Burgenland aufgefunden worden sind. EU-Vizepräsident Frans Timmermans und Kommissar Dimitris Avramopoulos haben in einer gemeinsamen Aussendung bekundet, dass sich die Migrationskrise „nicht irgendwo weit weg, sondern bereits vor unseren Augen“ abspielt. Und dass es sich dabei um „eine europäische Krise“ handle, auf die es „eine kollektive europäische Antwort“ geben müsse. Daher sei das jetzt „der Moment für gemeinsame Aktionen und Solidarität mit allen Mitgliedsstaaten“. Die Botschaft war insbesonders an jene EU-Länder adressiert, die immer noch so tun, als würden sie die hunderttausenden Asylanten, die nach Europa gekommen sind und noch kommen werden, absolut nichts angehen.
Brüssel hat viel Zeit…
Wobei eines immer deutlicher wird: Der Grieche Avramopoulos wirkt als der für Migrationspolitik zuständige EU-Kommissar ziemlich überfordert und gilt als nicht unwesentlicher Teil des derzeitigen Dilemmas. Früher u. a. Bürgermeister von Athen, Minister für Tourismus, Verteidigungs- bzw. Außenminister, übt er seinen jetzigen Job ohne nennenswerte einschlägige Erfahrungen und ohne das nötige Pouvoir erst seit 2014 aus. So gesehen ist es nicht überraschend, dass es – wie er gerne formuliert – zur „schlimmsten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ weder „eine einfache noch eine einzige Antwort“ gebe: „Es ist völlig klar“, sagte er unlängst, „dass wir eine neue, stärker europäisch ausgerichtete Strategie brauchen“. Kein Mitgliedsstaat sei in der Lage, die Migration allein in den Griff zu bekommen. Brüssel ebenfalls nicht.
Wo bleibt die neue Strategie? Die Europäische Gemeinschaft hat zwar für den Zeitraum 2014 – 2020 nicht weniger als sieben Milliarden Euro budgetiert, um den Mitgliedsstaaten exakt 58 nationale Programme zu ermöglichen. So lange etliche Länder – etwa Polen, Tschechien und die Slowakei, aber auch Großbritannien oder Portugal dieses Riesenproblem boykottieren, während sich andere, beispielsweise Deutschland, Schweden und Österreich, geradezu zersprageln, muss eine gemeinsame, solidarische und effiziente Vorgehensweise der Union reine Illusion bleiben. Die machtlosen EU-Gewaltigen scheinen deshalb auch enorm viel Zeit zu haben. Im Gegensatz zu UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der für 30. September einen weltweiten Flüchtlingsgipfel in New York einberief, hat EU-Chef Juncker offenbar keine Eile: Er sieht – so wie Angela Merkel, aber anders als etwa Österreichs Außenminister Sebastian Kurz – keine Notwendigkeit für einen raschen EU-Krisengipfel der Staats- und Regierungschefs, weil diese in Malta ohnedies zusammentreffen würden – und zwar im November (!). Als schwacher Trost mutet es an, dass von der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft zumindest ein Sondertreffen der EU-Innen- und Justizminister für den 14. September anberaumt wurde.
Österreichs Bundeskanzler ist angesichts der dramatischen Lage – allein am vergangenen Samstag meldete die rot-weiß-rote Polizei 2.700 Neuankömmlinge – der Kragen geplatzt: Werner Faymann, der mit seiner Gemeinde-Quotenregelung kläglich gescheitert ist und nunmehr auf den neuen Flüchtlingskoordinator, Ex-Raiffeisen-Boss Christian Konrad, hoffen muss, meldete sich mit dem Vorschlag zu Wort, die EU-Subventionen für jene Staaten zurückzuhalten, die nicht bei einer besseren Aufteilung von Flüchtlingen mitzumachen bereit seien. Mag sein, dass diese auch von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner goutierte Idee nicht mehr sein kann als ein Rohrkrepierer, weil es letztlich undenkbar ist, dass einige – solidarische – Länder den unsolidarischen so einfach den Geldhahn zudrehen können. Doch so lasch wie bisher darf die Brüsseler Kommission einfach nicht mehr weiter agieren. Das heisst: Es wird für die Ignoranten unbedingt und sehr rasch Sanktionen geben müssen.
Solidarität – nur eine Fiktion?
Und noch etwas wäre von entscheidender Bedeutung: So wie in Österreich, wo sich der Bund per Verfassungsgesetz das Durchgriffsrecht bei der Unterbringung von Asylwerbern gesichert hat, um widerspenstige Landeshauptleute und letztlich auch unkooperative Bürgermeister zu disziplinieren, würde auch die Europäische Union dringend ein Durchgriffsrecht gegenüber ihren 28 Mitgliedern benötigen. Aus aktueller Sicht scheint das ein geradezu utopisches Unterfangen zu sein, weil etliche Staaten zwar auf ihre auf der EU-Mitgliedschaft beruhenden Vorteile pochen, aber kaum Gegenleistungen erbringen bzw. im Ernstfall null Verantwortung übernehmen möchten.
Der im Vertrag von Lissabon festgeschriebene Grundsatz der Solidarität und gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedern ist im konkreten Fall lediglich eine Fiktion. Es wäre folglich an der Zeit, dass alle nationalen Regierungen endlich erkennen, dass die Union so nicht funktionieren kann. Es macht gar keinen Sinn, die EU-Spitzen wegen Untätigkeit zu kritisieren, weil sie derzeit noch kein Pouvoir haben, mit den einzelnen Ländern konkrete, verbindliche Quoten auszuhandeln, wie viele Asylwerber diese aufnehmen müssen, und die Einhaltung dieser Vorgaben sodann penibel zu überwachen. Nur mit einer Reform der Machtstrukturen wäre in Sachen Flüchtlinge das erforderliche Krisenmanagement auf europäischer Ebene möglich – und damit die humanitäre Bewältigung des vermutlich größten europäischen Problems der kommenden Jahre. Sofern aber alles beim Alten bliebe, werden Jean-Claude Juncker und sein Team weiterhin nur schöne Reden halten, gut gemeinte Vorschläge machen und sich mit hilflosen Appellen begnügen können.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com