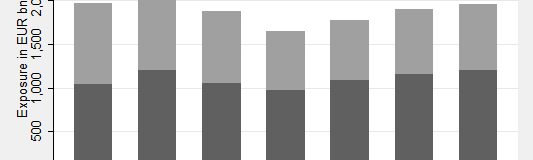Es ist wie eine Sucht: Die Märkte verlangen immer höhere Dosen an Liquidität. Viele Marktteilnehmer erwarten eine Nullzinspolitik und neue Geldleihprogramme der EZB. Das stimuliert zwar kurzfristig die Börsen, birgt aber mittelfristig erhebliche Risiken.
[[image1]]Die überraschende Zinssenkung durch die EZB im November hat, wie es scheint, die Phantasie der Marktteilnehmer nachhaltig beflügelt. Immer mehr Beobachter am Finanzplatz Frankfurt erwarten schon in naher Zukunft eine Null-Zins-Politik. Tatsächlich spekulierten manche Börsianer schon Anfang Dezember auf eine neuerliche Zinssenkung – von 0,25 auf dann 0,00 Prozent. Dieses Mal wurden sie enttäuscht. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.
Kaum war klar, dass die Börse nicht mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk rechnen durfte, da gaben die Aktienkurse zum Teil deutlich nach. Diese Reaktion macht überdeutlich, was die Börse in den vergangenen Wochen von einem Allzeithoch zum nächsten trieb – es war der durch die Niedrigszinspolitik ausgelöste Liquiditäts-Tsunami. Und im nächsten Jahr würden gerade die europäischen Aktien erneut durchstarten, jubilieren viele Börsianer, denn die Aktienanlage sei „alternativlos“. Dabei hatten wir gerade erst gelernt, dass – vom Tod abgesehen – eben nichts alternativlos ist im Leben.
Dennoch spricht auf der Zielgeraden des Jahres 2013 vieles für eine Fortsetzung der Politik des billigen und am Ende vielleicht sogar zinslosen Geldes. Sehr wahrscheinlich sind sogar weitere „Lockerungsübungen“. Die könnten zum Beispiel darin bestehen, die Leitzinsen auf die Nulllinie zu drücken. Eine in jüngster Vergangenheit häufiger diskutierte Alternative wäre es, für Einlagen bei der EZB negative Zinsen zu berechnen. Wenn also eine Bank Geld bei der Zentralbank bunkert statt es in Form von Krediten weiterzureichen, müsste sie sozusagen Strafe zahlen.
Neues Geldleihgeschäft ante portas?
Am wahrscheinlichsten dürfte aber ein erneutes langfristiges Geldleihgeschäft für die Banken sein. Einschlägige Erfahrungen hat die EZB bereits gesammelt. Wir erinnern uns: Vor etwa zwei Jahren legte die Zentralbank zwei billionenschwere Geldleihgeschäfte für Geschäftsbanken auf, um der Kollapsgefahr auf dem Interbankenmarkt entgegenzuwirken. Viele bezeichnen dies als Anfang vom Ende der akuten Euro-Krise. Das System funktionierte verblüffend einfach: Die Geschäftsbanken liehen sich zu absoluten Discount-Konditionen für die Dauer von drei Jahren frisches Geld von der Zentralbank und kauften damit Staatsanleihen der Krisenländer. Und das nicht zu knapp: Noch Anfang 2008 befanden sich nur etwa 6,5 Prozent aller spanischen Staatsanleihen in den Depots spanischer Banken. Derzeit sind es über 34 Prozent. Italienische Banken bunkern Staatsanleihen ihres Landes in einem Gesamtvolumen von 415 Milliarden Euro. Zu Beginn der Krise waren es 240 Milliarden Euro. Indirekt finanziert also die EZB die defizitären Haushalte der Euro-Staaten. Das darf zwar strenggenommen nicht sein, trug aber zumindest kurzfristig zu einer deutlichen Beruhigung der Euro-Krise bei.
Was also spricht dagegen, erneut ein Geldleihgeschäft aufzulegen, von dem dieses Mal die Unternehmen profitieren könnten? Und tatsächlich tun sich die Firmen in den Euro-Krisenländern derzeit schwer, an neue Kredite zu kommen. Allein im Oktober sanken die Ausleihungen an Unternehmen in diesen Staaten um 3,7 Prozent.
Hinter dieser Strategie steht die Annahme, die Zins- und Geldpolitik sei ein probates Allheilmittel, mit deren Hilfe man nahezu alle ökonomischen Probleme lösen könne. Die EZB senkt die Zinsen und legt Geldleihgeschäfte auf – und schon fließen wieder reichlich Kredite in die Unternehmen, die investieren, neue Märkte erobern und Jobs schaffen.
Doch bei dieser Betrachtungsweise wird eine schlichte Tatsache ausgeblendet: Ob und wann ein Unternehmen investiert, hängt nicht vorrangig vom Preis des Fremdkapitals ab. Der ist nur eines von vielen Entscheidungskriterien. Tatsächlich haben viele Unternehmen in den Krisenstaaten in den vergangenen Jahren hohe Schuldenberge aufgebaut. Warum sollten sie diese nun sogar noch erhöhen, nur weil die Konditionen besonders günstig sind? Obwohl in Spanien und Italien leichte Anzeichen einer wirtschaftlichen Stabilisierung erkennbar sind, bleibt die konjunkturelle Situation zumindest mittelfristig fragil und die Arbeitslosigkeit hoch. Weshalb sollten also die Unternehmen ausgerechnet jetzt neue Schulden machen und Maschinen kaufen, um Kapazitäten auszuweiten, die sie vermutlich gar nicht brauchen?
Die EZB als Kreditsteuerungsbehörde
Und die Vorstellung, dass die EZB in letzter Konsequenz zu einer gigantischen und politisch motivierten Kreditsteuerungsbehörde mutieren könnte, ist für überzeugte Marktwirtschaftler ebenfalls nicht gerade behaglich. Zumal die letzte Zinssenkung im November einmal mehr gezeigt hat, dass im EZB-Rat die Vertreter einer weniger expansiven Geldpolitik hoffnungslos in der Minderheit sind. Die Länder im Süden der EU geben nun die Richtung vor.
In Staaten wie Deutschland und Österreich führt derweil die Niedrigzinspolitik bei den Privatkunden der Banken zu teils waghalsigen Finanzierungen. Boulevard-Zeitungen preisen schon Immobilienkäufe mit 100 Prozent Finanzierung an. Ohne einen Euro Eigenkapital in die eigenen vier Wände. Besorgte Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang bereits von einer Subprimekrise 2.0. Doch im Gegensatz zum Auslöser der Finanzkrise in den USA gibt es in den wirtschaftlich stabilen Ländern des Euroraums einen entscheidenden Unterschied, der freilich nicht unbedingt beruhigt. In den Vereinigten Staaten erhielten seinerzeit sogar Bankkunden Kredite zum Kauf überteuerter Immobilien, die weder über Eigenkapital noch über ein gesichertes Einkommen verfügten.
In Ländern wie Deutschland weisen die 100-Prozent-Finanzierer hingegen in der Regel eine ausreichende Bonität dank eines regelmäßigen Einkommens auf. Vordergründig nehmen sich die Risiken daher geringer aus als seinerzeit in den USA. Und dennoch handelt es sich um „Pulverfässer“, weil die Betreffenden meist über keine finanziellen Polster verfügen, sonst müssten sie ja nicht zu 100 Prozent finanzieren. Steigende Zinsen und wieder fallende Immobilienpreise können das riskante Finanzierungs-Konstrukt dann schnell zum Einsturz bringen.
Mit der Niedrigzinspolitik ist es eben wie mit starker Medizin: Kurzfristig bringt sie Linderung, mittel- bis langfristig indessen sind die Nebenwirkungen beträchtlich.
Bild: Morgenrot/www.pixelio.de
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com