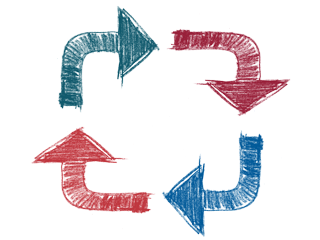
Österreich ist seit Beginn der Zweiten Republik von einer ziemlich ausgewogenen Zweiteilung des politischen Lagers gekennzeichnet. Derzeit scheint aber Mitte-Rechts einen gewissen Überhang aufzuweisen.
Die unruhige politische Wetterlage, die latente Terrorgefahr, der Flüchtlingsstrom nach Europa, die Ungewissheit über die künftige Entwicklung der EU lassen die Menschen wieder stärker zusammenrücken. Für die Politologen drückt sich das in verschiedenen Reaktionen und Verhaltensnormen der Wähler aus. So etwa im Ruf nach einer starken Führungspersönlichkeit, in einem Vertrauenszuwachs für etablierte Parteien oder auch einem breiten Zuspruch zu Bewegungen, die ein Aufbrechen verkrusteter Zustände, einem entschlossenen Handeln mit verständlichen Zielvorstellungen versprechen. Daher der wachsende Vertrauensbeweis für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der Wahlerfolg von Emmanuel Macron in Deutschland und der Zulauf, den Sebastian Kurz verzeichnet. Für Nischenparteien, von den Grünen bis zu den NEOS bleibt in einer solchen Situation wenig Spielraum übrig.
Team Stronach sagt Adieu
Mit der Ankündigung, dass das Team Stronach (TS) bei den kommenden Nationalrastwahlen auch nicht unter einem anderen Namen mehr antreten wird, wird nur der Realität Rechnung getragen. Alles läuft auf eine Konfrontation von ÖVP, SPÖ und FPÖ hinaus. Mehr noch, es werden damit kaum noch Wähler freigesetzt. Als der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach 2013 in die österreichische Politik einstieg, mischte er noch kurzfristig die Szene auf. Die rund 10 Prozent, die er bei den Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten sowie Salzburg und die 5,7 Prozent, die er bei den Parlamentswahlen erhielt, sind längst verflogen. Stronach hat seine Wähler durch seine skurrile Art bei Fernsehauftritten selbst vertrieben. Zuletzt blieb das Team Stronach in den Umfragen nur noch unter der Wahrnehmungsgrenze.
Pilz nagt am grünen Stamm
Bei den Grünen, die seit Jahren sich bei einem Stimmenanteil von etwa 12 Prozent eingependelt haben, kommt es derzeit gerade zu einer Implosion. Sie bekommen nun ihr Lavieren zwischen einer fast schon besessenen Umweltpolitik und der Sucht sich ein linkes ideologisches Korsett zu geben, zu spüren. Mit dem abrupten Abtritt der Grün-Pragmatikerin Eva Glawischnig, wurde innerparteiliches Konfliktpotential freigelegt. Die Jungen Grünen wollen zur KPÖ. Die neue Führungsspitze mit Ulrike Lunacek und Ingrid Felipe muss – kaum gewählt – hilflos zusehen wie der Langzeitabgeordnete Peter Pilz keinen Listenplatz mehr erhält und gewissermaßen vor die Tür gesetzt wird. Seine Reaktion, nämlich eine eigene Kandidatur zu überlegen, mag aufgrund der gekränkten Eitelkeit verständlich sein, würde letztlich nach Ansicht der Politologen zu einer Spaltung der Grünen an sich führen.
Kein Potential für zwei grüne Parteien
Der Zuspruch, den derzeit Pilz erfährt, kommt vor allem aus dem links-grünen Spektrum und einer bestimmten Kulturszene. Eine eigene Liste Pilz würde die Grüne Alt-Partei von derzeit 9 auf etwa 6 Prozent reduzieren. Pilz selbst dürfte davon profitieren, versprengte Grünwähler wieder zurückholen. Und er könnte auch noch zur Gefahr für die SPÖ werden, indem er das zweifellos vorhandene und von Kern enttäuschte linke SP-Klientel anspricht. Vielmehr als auf Augenhöhe mit Lunacek stehen zu kommen, wird ihm derzeit aber nicht zugetraut. Daher wird der grüne Diskurs dazu führen, dass sich eine Partei, die noch vor Jahren, alle Chancen hatte, von SPÖ ebenso wie der ÖVP als Partner in eine Koalition geholt zu werden, selbst degradiert. Das Grün-Wähler-Potential ist nämlich beschränkt, weil Umweltschutz längst von allen Parteien gepflogen wird. Diese Einsicht könnte vielleicht noch zu einem Umdenken führen, bis zum Wahltag aber die Partei nicht ins Entscheidungsspiel um eine Regierungsbeteiligung bringen.
Gefestigtes Mitte-Rechts-Lager
Gefestigt hat sich dagegen das so genannte Mitte-Rechts-Lager. Übrigens ein Trend in vielen EU-Staaten, wie vor allem die Verluste sozialdemokratischer Parteien laufend zeigen. Genau genommen hält es seit den Nationalratswahlen 1983, als es damals Alois Mock gelang, Bruno Kreisky die absolute Mehrheit abzujagen, eine Mehrheit. Und dabei ist es seit nunmehr 32 Jahren geblieben. Trotzdem wurde nur sechs Jahre lang das Land auch von einem ÖVP-Bundeskanzler regiert. 26 Jahre lang führte dagegen die SPÖ die Regierungsgeschäfte, war die Volkspartei gewissermaßen nur Mitläufer. Mit ein Grund dafür war, dass die Volkpartei kein Alleinstellungsmerkmal für das so genannte bürgerliche Lager aufwies, sondern immer wieder mit Konkurrenz zu kämpfen hatte.
Absturz der so genannten Großparteien
Noch vor dem Ende des Wahlkampfes 1986 hatte die ÖVP, die selbst groß den „Kurswechsel“ propagierte, den Fehler begangen, die so genannte alte große Koalition als den neuen Hoffnungsträger zu propagieren. So sehr letztlich das rot-schwarze Bündnis die Suche Österreichs nach einem gemeinsamen Weg zur Europäischen Union erleichterte, die ÖVP bekam die Rechnung präsentiert, indem enttäuschte bürgerliche Wähler sich der FPÖ zuwandten. Der schon damals erhobene Vorwurf, diese würde eine populistische Politik betreiben, zog beim Wähler nicht. Dieser wollte kein Herumreden, sondern dass Tatsachen beim Namen genannt werden. Die Freude bei der SPÖ, dass nun die FPÖ endlich die Position der Volkspartei schwächen würde (eine Intention, die führende Sozialdemokraten bereits 1949 mit der Unterstützung für die Gründung der VdU, der FPÖ-Vorgängerorganisation, verfolgt hatten), währte nur kurz. Sackte die ÖVP 1990 erstmals von über 40 auf etwas mehr als 30 Prozent ab, so wiederfuhr der SPÖ dieses Schicksal bei den Wahlen 1995. Die FPÖ war tief ins sozialdemokratische Wählerreservoir eingebrochen.
50 Prozent mobile Wähler
Dahinter verbirgt sich der Abschied von der Parteibuchgesellschaft und eine ständig wachsende Wählermobilität. Von Kriegsende bis zum Ende der 1980er Jahre gab es nur zwei Großparteien, nämlich ÖVP sowie SPÖ, und die konnten sich die Wählerschaft aufteilen, schwankend zwischen 43 und 50 Prozent. Der Anteil der so genannten Wechselwähler bewegte sich gerade einmal bei etwa 10 Prozent. Die Stammwählerschaft bildete den festen Kern bei Rot wie Schwarz. Bei den kommenden Wahlen am 15. Oktober rechnet man bereits mit einem Wechselwählerpotential von fast 50 Prozent. Damit einhergehen die Mitgliederzahlen von SPÖ und ÖVP. Sprach man noch vor 25 Jahren bei beiden Parteien von Mitgliederzahlen in der Größenordnung von 600.000 bis 700.000, so sind dies um gut zwei Drittel gesunken. Bei der SPÖ redet man von etwa 200.000 Parteimitgliedern, bei der ÖVP dürften es etwas mehr sein, aber dies auch nur deshalb, weil beim Bauernstand auch gleich die Familienmitglieder mitgezählt werden.
Wählerpräferenz für Schwarz-Blau
Die Mobilität der Wähler hat letztlich dazu geführt, dass es heute anstelle von zwei Groß- eben drei Mittelparteien gibt. Politologen rechnen daher auch in etwas mehr als drei Monaten mit einem etwa gleichwertigen Dreikampf. Interessant in diesem Zusammenhang ist schließlich auch noch, welche Koalitionsregierung am Wunschzettel der Österreicher steht. Mit 37 Prozent ist ÖVP-FPÖ die erste Wahl. Jene der SPÖ mit der FPÖ liegt mit nur 16 Prozent am letzten Platz. Nicht viel besser ist es um eine Fortführung von Schwarz-Rot bestellt, diese wollen gerade einmal 21 Prozent. Die Dreier-Variante SPÖ-Grüne-NEOS käme zwar mit 26 Prozent auf den zweiten Platz, fällt aber aus dem Rennen, da diese drei Parteien derzeit auch zusammen keine Mehrheit schaffen.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com



